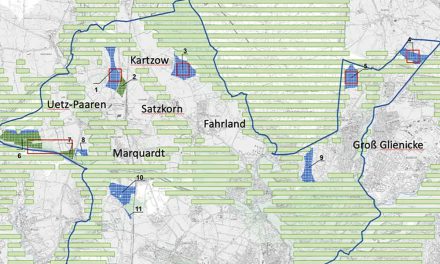Koljada beim Gottesdienst in der Christi-Auferstehungs-Kathedrale (Berlin)
Fotos: privat
Ein Gespräch mit dem Erzdiakon der russisch-orthodoxen Alexander-Newski-Gedächtniskirche
Teil 5 der Serie „Potsdams russische Wurzeln“
Vor 34 Jahren zog der damals elf Jahre alte Daniel Koljada mit seinen Eltern und seinen Geschwistern aus der Sowjetunion nach Potsdam. Im Interview mit dem POTSDAMER erzählt der heutige Erzdiakon der russisch-orthodoxen Alexander-Newski Gedächtniskirche in Potsdam, wie seine Familie in die damalige DDR kam, warum er den Weg des Kirchendieners gewählt hat, wie er die Wende erlebte und über vieles mehr.
Woher kommen Sie und seit wann sind Sie in Potsdam?
Geboren bin ich 1975 in Lettland, in der Stadt Libawa. Damals gehörte Lettland noch zur Sowjetunion. Mein Vater war damals an der Technischen Universität von Riga tätig. Als er 1980 die Priesterweihe bekam, ist er mit uns allen nach Weißrussland, seiner Heimat, zurückgekehrt. Dort bin ich auch in die Schule gegangen.
Mein Vater ist nicht nur ein sehr gläubiger Mann, sondern auch einer, der für seine Ansichten einsteht und sie verteidigt. Das war nicht immer gern gesehen. Nachdem mein Vater in Belarus drei Kirchen wiederaufgebaute und einen Prozess gegen die Sowjetmacht gewonnen hatte, wollte man ihn aus Weißrussland weghaben. So wurde er 1986 nach Potsdam strafversetzt. Und die ganze Familie ging mit ihm. Ich war damals elf Jahre alt.
Was waren für Sie die größten Herausforderungen als Kind und später als Jugendlicher, als Sie in die DDR kamen, einem Land, das wenig öffentlichen Bezug zur Kirche hatte?
In der DDR gab es im Gegensatz zu der Sowjetunion oder Weißrussland mehr Religionsfreiheit, und deshalb war es für mich in Potsdam leichter, meinen Glauben auszuüben. Wenn ich in Weißrussland oder in Russland die Ferien bei meinen Großeltern verbrachte, wurde ich immer als Popensohn oder Priestersohn gehänselt. In der DDR war das nicht so, weil ich hier ja sowieso ein Außenseiter als Ausländer war. Damals war auch noch die Rote Armee hier stationiert und ich hatte viele Freunde aus der Schule sowie aus dieser Umgebung. In der DDR war man nicht so kritisch oder lehnte unsere Religion ab, ganz im Gegensatz zu vielen Menschen in Russland oder Weißrussland, die keinen Bezug zur russisch-orthodoxen Kirche hatten.
Seit 1986 leitet Ihr Vater, Erzpriester Anatolij Koljada, die russisch-orthodoxe Alexander-Newski Gedächtniskirche in Potsdam. Wann haben Sie sich entschieden, Ihrem Vater beruflich zu folgen und warum? Wie einfach war es für Sie, diese Entscheidung zu treffen?
Die Entscheidung wurde mir wahrscheinlich fast in die Wiege gelegt, weil ich seit meinem fünften Lebensjahr in der Kirche diene. Da ich in der Kirche aufwuchs, war das für mich nur eine Frage der Zeit. Meine beiden Großväter sind auch Priester. Die Arbeit als Geistlicher hat bei uns also schon seit Generationen Tradition. Ich wollte das dann wahrscheinlich fortsetzen, obwohl ich auch einen zivilen Beruf habe und ihn ausübe. Ich habe an der Technischen Universität Berlin an der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsmathematik studiert.
Da die Gottesdienste meistens am Wochenende sind, arbeite ich unter der Woche. Samstags und sonntags bin ich dann in der Kirche tätig. Außerdem kann ich in meinem weltlichen Beruf die Arbeitszeit selbst bestimmen. Natürlich ist es aber eine Doppelbelastung.

1988, vor der russisch-orthodoxen Alexander Newski Gedächtniskirche Kirche. Der 13-jährige Daniel Koljada (r.) trägt als Altardiener o. Ministrant einen Kelch mit geweihten Wasser.
Noch sind Sie kein Priester, sondern ein Diakon. Das heißt, dass Sie selbstständig noch keine Gottesdienste leiten können, sondern dem Priester dabei helfen? Möchten Sie denn Priester werden?
In der Zukunft, ja. Man bekommt dann von dem Bischof die Priesterweihe. Die Voraussetzungen dafür sind ein abgeschlossenes Priesterseminar und eine Ehe. In der orthodoxen Kirche muss man als Priester entweder mit der ersten und einzigen Ehefrau verheiratet sein oder man schlägt den anderen Weg ein und wird Mönch. Ich habe den ersten Weg gewählt und habe daher diese Auflage bereits erfüllt.
Ist Ihre Frau Russin, und haben Sie sie in Deutschland (Potsdam) kennengelernt?
Meine Frau habe ich in Potsdam kennengelernt, als sie mit einem weißrussischen Chor der auf Einladung unserer Gemeinde Benefizkonzerte veranstaltete, hier in Deutschland mit dabei war. Sie kommt aus einem kleinem aber sehr Kultur- und Geschichtsprächtigen und einer der ältesten Städte der alten Rus. (862) – Stadt Polozk im Norden von Belarus.

Erzdiakon Daniel Koljada
Arbeiten einige Ihrer sechs Kinder auch in der Kirche mit? Dürfen Jungen und Mädchen (Männer und Frauen) in der russisch-orthodoxen Kirche arbeiten oder nur Jungen bzw. Männer?
Natürlich, wenn Sie Zeit haben, helfen sie mit, Jungs begleiten den Gottesdienst als Ministranten und Leser, Mädels singen in dem Chor. So haben wir im Frühlingslockdown vor Ostern fast einen Monat mehrere Gottesdienste nur mit Hilfe und im Kreise unserer Familie zelebriert.
Als Geistliche dürfen in der orthodoxen Kirche nur Männer dienen, die Frauen können aber den Gottesdienst mit Gesang verschönern, oder als Psalmleserin oder, wie meine Frau als Chorleiterin (Kantorin) arbeiten. Außerhalb des Gottesdienstes gibt es in anderen Aufgabenfeldern der Gemeinde für die Frauen fast keine Beschränkungen.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Gottesdienst in Potsdam?
Das war gleich nach unserer Anreise hierher. Es war ein bisschen befremdlich, da damals noch sehr wenige Menschen zu den Gottesdiensten kamen. Allerdings konnte man schnell Kontakte knüpfen. Die Menschen kamen auf einen zu, sprachen sogar ein wenig Russisch, das sie in der Schule als „Pflichtsprache“ gelernt hatten.
Unterscheidet sich ein heutiger Gottesdienst von einem Gottesdienst in den 1980er und 1990er Jahren?
Als wir hierhergekommen sind, hatten wir sehr wenige Gemeindemitglieder und dienten quasi über Wochen hinweg nur im Kreise unserer Familie. Später kamen sechs, acht Leute hinzu. Heute kommen zu einem normalen Gottesdiensten 80 bis 100 Gemeindemitglieder. An Festen natürlich mehr. Aber jetzt haben wir leider Covidzeit. Die Leute müssen sich anmelden, und es wird dann eben Wochen im Voraus gebucht. So können immer noch 25 bis 30 Gemeindemitglieder jedes Wochenende kommen.

1992 das Abschlussjahr: Schloss Cecilienhof in Potsdam. Künftiger Erzdiakon Daniel Koljada (vordere Reihe links) mit seinen Klassekameraden
Als Ihre Familie nach Potsdam zog, herrschte dort noch eine sozialistische Ära. Sie sind in ein Land gekommen, das es jetzt nicht mehr gibt, wie es aber auch kein Land mehr gibt, aus dem Sie vor 34 Jahren gekommen sind. Gemeint sind natürlich die DDR und die UdSSR. Wie sehr haben die geopolitischen Veränderungen Ihre Tätigkeit als Kirchendiener und als Privatperson beeinflusst?
Wir haben die Wende live miterlebt. Mein Vater war damals bei dem Treffen der evangelischen und katholischen Gemeinden, die im Hintergrund die Protestbewegung in der DDR mitaufgebaut hatten. Ab und zu war ich damals dabei gewesen und habe den Prozess der Wende sehr bewusst miterlebt. Ich habe das Bestreben des deutschen Volkes zu der Wiedervereinig gespürt. Aber danach war leider dieser Bruch von sozialistischer Lebensweise in kapitalistische Marktwirtschaft sehr abrupt, indem die Leute aus dem Westen hierherkamen, viele Betriebe in einer Nacht geschlossen und zahlreiche Menschen arbeitslos wurden. Es war auch für die Deutschen hier in Potsdam ein sehr starker Einschnitt in ihre Lebensweise.
Schon vor der Wende hatten wir in unserer Gemeinde Mitglieder, die nach Westen ausgewandert sind und uns später von dort geholfen haben. Viele Jugendliche sind in den Westen gezogen, weil sie dort bessere Arbeitschancen hatten. Jetzt, nach 30 Jahren, ist es ungefähr wieder im Lot. Aber es gibt immer noch Menschen, die DDR-Nostalgiegefühle haben oder aber auch die, die anders gesinnt sind. Da ich quasi zwischen den zwei Welten war, habe ich es von beiden Standpunkten aus gesehen. Ich war ja als Außenstehender nicht direkt betroffen. Meine Familie war hier wie auf einer Dienstreise. Erst nach der Wende haben wir uns hier, Gott sei Dank, richtig niedergelassen.
Und es war interessant anzusehen, wie dieser Wendeprozess in die Sowjetunion übergeschwappt ist und so auch mit zur Eigenständigkeit der verschiedenen Republiken beigetragen hat.
Ähnliche Gefühle, wie einige Ostdeutschen, erleben auch viele Menschen in Russland, die nostalgisch auf die vergangene Sowjetunion blicken. Gehören Sie auch dazu?
Man kann mich nicht zu denjenigen zählen, die nostalgisch zurück auf die Sowjetunion gucken. Wie gesagt, bin ich hauptsächlich hier in Potsdam aufgewachsen. Natürlich hatte ich immer sehr starken Bezug zu Russland und Weißrussland. Dort habe ich immer noch viele Verwandte und Bekannte. Ich reise in der Regel zwei-, dreimal pro Jahr dorthin, um Verwandte zu besuchen. Heute mache ich dort Urlaub, wo ich als Kind meine Sommerferien verbracht habe. Ich schaue deshalb nicht wehmütig zurück, weil ich immer die Gelegenheit hatte, in meine alte Heimat zu reisen. Wir waren auch nie so stark von der russischen Kultur getrennt, wie man vielleicht annimmt. Ich denke aber oft und gerne an meine Schulzeit, weil ich hier von der sechsten bis zur elften Klasse in die Militärschule gegangen bin und diese absolviert habe. Ich denke, die Schulzeit ist für viele Menschen eine besondere Zeit im Leben und die bleibt immer in der Erinnerung.
Mehr über Daniel Koljada und seine Arbeit als Erzdiakon erfahren Sie in der kommenden Ausgabe.
Das Interview mit Erzdiakon Daniel Koljada führte unsere Mitarbeiterin Femida Selimova